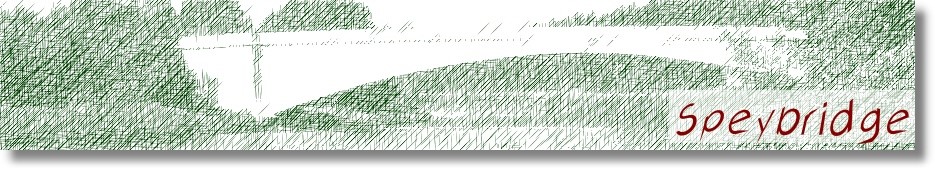Der Blick auf das Kind
Die Mainpost veröffentlicht einen Bericht über die neue Direktorin einer großen Grundschule. Ein Teil des Interviews mit der Dame gefiel mir gut:
“Manchmal stellt sich bei solchen Tests heraus, dass ein Schüler hochbegabt ist. Wie gehen Schüler, Eltern und vor allem auch die Schule mit einem solchen Ergebnis um?
Albert: Interessant ist folgender Unterschied in der Verhaltensweise der Kinder: Die Jungs fielen vorher oftmals auf, da sie den Unterricht störten. Die Mädchen klagten zu Hause über Langeweile im Unterricht, verhielten sich in der Schule aber eher unauffällig. Wenn ein Schüler mit dem Testergebnis Hochbegabung kommt, so schaue ich mir die Kinder erst einmal an. Bei vorliegender Hochbegabung ist eine individuelle Förderung für diejenigen wichtig, die mehr wollen. Man muss dann genau überlegen, welche zusätzliche Förderung für das Kind gut ist, zum Beispiel eine privat organisierte Gruppe oder der Besuch einer Kinderakademie. Andere Kinder sind nach dem Test einfach nur froh zu wissen, was mit Ihnen los ist und wollen weiter so zur Schule gehen wie bisher.”
Eigentlich ganz schlicht, diese Antwort – und wiederum “einfach nur” der differenzierte Blick auf das einzelne Kind mit der pädagogisch motivierten Frage: “Was braucht dieses Kind?”
Nicht mehr.
Nicht weniger.