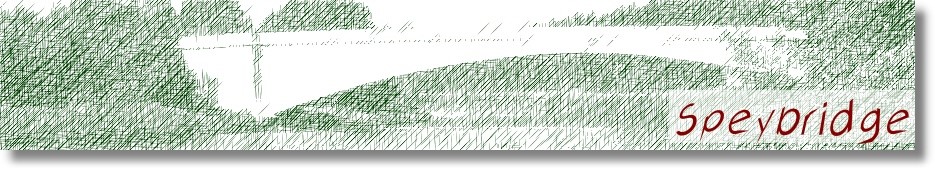Streitfrage Bildungsgerechtigkeit
Lesen, Meinung bilden, Kommentare schreiben zum Artikel auf Welt Online – bitte:
Chancengleichheit in der Bildung ist Illusion
Auszüge:
“Eine Studie des Züricher Erziehungswissenschaftlers Helmut Fend, die vor Kurzem veröffentlicht wurde, weist nach, dass Gesamtschulen nicht mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen als die Schulen im gegliederten Bildungssystem. 23 Jahre lang wurden hessische Jugendliche in ihrem schulischen Werdegang wissenschaftlich begleitet. Der Befund ist eindeutig: Ob ein Jugendlicher eine Lehre macht oder studiert, hängt stark vom sozialen Status der Eltern ab. Welche Schulart er besucht hat, spielt dabei kaum eine Rolle.
Warum dann der hartnäckige Kampf um die Einheitsschule, der wie ein Glaubenskrieg ausgefochten wird? Warum sind deren Befürworter immun gegen alle empirischen Befunde, die die Heilserwartungen der Einheitsschule als Schimäre ausweisen? Man kann vermuten, dass die Vehemenz der Forderung Ausdruck einer tief sitzenden Kränkung ist. Einer Kränkung darüber, dass es junge Menschen gibt, denen – unverdient – alles zufliegt, weil sie das Glück haben, in bildungsbeflissenen Elternhäusern heranzuwachsen, während andere – unverschuldet – in Milieus hineingeboren werden, die sie von Anfang an in ihrer Sozialisation benachteiligen. Letztlich ist für die Vertreter der Einheitsschule Bildungspolitik eine verkappte Form von Sozialpolitik.Die Benachteiligungen von Kindern beginnen, wie man heute weiß, sehr früh. Wenn eine schwangere Frau häufig klassische Musik hört, entwickelt das Neugeborene schon früh ein Rhythmusgefühl, die Vorstufe von Musikalität. Wenn kleinen Kindern regelmäßig vorgelesen wird, bilden sie ein differenziertes Sprachvermögen aus und schreiben schon in der Grundschule verblüffend gute Texte. Wenn ein Kind im Elternhaus erlebt, dass die Eltern elaboriert reden und diskutieren, überträgt sich dieses sprachliche Vermögen auf das Kind. Es wird zum verbal geschickten, selbstbewussten Streiter in eigener Sache.
Wenn ein Kind Lob und Zuspruch erfährt, wenn es die Welt im Spiel entdeckt, wird es später auch im schulischen Lernen Neugier und Ehrgeiz entwickeln. Wenn man sich von all diesen stimulierenden Anreizen das Gegenteil denkt, kann man ermessen, wie tiefgründig und wie nachhaltig die Handicaps und Defizite sind, mit denen die Kinder zu kämpfen haben, die in bildungsfernen Elternhäusern heranwachsen müssen. Schon in der Grundschule sitzen sie im hintersten Waggon des Geleitzuges.”
“Was noch zu wenig geschieht, ist die Förderung der Hochbegabten unter den Schülern. Diese Aufgabe aus ideologischen Gründen zu unterlassen wäre genauso unmenschlich, als wenn man die schwachen Schüler ihrem Schicksal überließe. Schon aus volkswirtschaftlichen Gründen können wir es uns nicht leisten, diese Kinder zu vernachlässigen. Sie sind die Garanten von Innovation und Erfindungsgabe, dem wichtigsten „Rohstoff“ in einem rohstoffarmen Land.”
”Das Motto müsste lauten: Vom Kampf um das beste Schulsystem zum Kampf um den besten Unterricht. Meine langjährigen Erfahrungen als Lehrer an unterschiedlichen Schulen haben mich nämlich gelehrt: Es gibt keine gute oder schlechte Schulform, es gibt nur guten und schlechten Unterricht, und zwar mitunter nebeneinander in derselben Schule, Wand an Wand. Hier liegt die wahre Quelle von Ungleichheit. Könnte man diese Unterschiede in der Unterrichtsqualität ausgleichen, und zwar bundesweit, hätte man für die Kinder mehr gewonnen als durch den Kampf um das richtige System.”