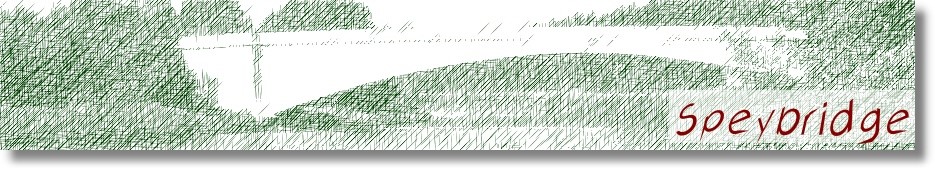So lautet der Titel eines im Juni in FAZ-Net veröffentlichten Interviews mit Detlev Rost, seines Zeichens Begabungsforscher.
Rost ist schon lange und generell dafür bekannt, eher abzuwiegeln, wenn es um spezielle Fördermöglichkeiten/-Klassen etc. für hochbegabte Kinder geht:
“Ja, heutzutage ist eine Förderhysterie ausgebrochen. Es gibt sehr viele Eltern, die glauben, ihr Kind würde nur noch aus dem Intellekt bestehen. … Ich will damit nicht sagen, dass man nichts für Hochbegabte tun soll. Aber auch hochbegabte Kinder brauchen Freizeit, hochbegabte Jugendliche müssen auch mal rumhängen und mal nicht gefördert werden.”
Und: “Sonderschulen sind immer Notlösungen, wenn es normale Schulen nicht schaffen, mit der Variabilität hinsichtlich der Begabungen zurechtzukommen.”
Rost sieht aber durchaus auch, dass beim Unterricht im Alltag, vor allem bei der Binnendifferenzierung, vieles im Argen liegt:
“Langeweile ist kein Zeichen für Hochbegabung, sondern für schlechten Unterricht.”
Und: “In Finnland zum Beispiel wird über Förderklassen oder Ähnliches erst gar nicht diskutiert. Der Lehrer richtet sich von Beginn an darauf ein, dass die Klasse sehr heterogen ist und dass er individuell differenzieren muss. Ein Lehrer, der zulässt, dass unterschiedliche Lernwege eingeschlagen werden, hat noch keinem geschadet – auch nicht den Hochbegabten.”
Das ist ja auch nicht falsch.
In Hochbegabtenkreisen hat Rost z.T. allerdings keinen besonders guten Ruf, auch, weil er sich ab und an über Organisationen, die sich des Themas Hochbegabung annehmen, in negativer Weise äußert und zu deren Nachteil durchaus schon einmal recht willkürlich Zitate miteinander vermischt.
Inhaltlich kann man dem, was Rost in oben zitiertem Artikel äußert, allerdings nicht wirklich etwas entgegenhalten. Er hat Recht.
Was ich aber dennoch an ihm und seiner Art, mit dem Thema Hochbegabung umzugehen, bemängele, ist, dass er – willentlich oder auch nicht – denjenigen Verantwortlichen Argumente, Material und Munition liefert, die sich mit dem Thema Hochbegabung erst gar nicht auseinandersetzen wollen und nicht daran denken, ihre eigene Art, z.B. zu unterrichten, eine Schule zu führen oder als Psychologe mit hochbegabten Kindern umzugehen, hinterfragen oder gar ändern zu wollen.
Ein mir bekannter Psychologe, Leiter einer städtischen jugendpsychiatrischen Einrichtung, bezieht sich in diesem Sinne immer auf Rost, wenn er generell leugnet, dass hochbegabte Kinder durchaus spezielle Probleme haben und u.U. besondere Förderung benötigen können. Er selbst empfiehlt als Therapie dann gerne die Pfadfinder und regelmäßige körperliche Betätigung.
Das ist ein Rückfall ins pädagogische/psychologische Mittelalter.
Es spricht absolut nichts dagegen, auch mit einem Phänomen wie Hochbegabung differenziert und kritisch umzugehen.
Ich denke, es kann aber auch nicht im Sinne eines Begabungsforschers sein, Vorschub dazu zu leisten, durch harte Aufklärungsarbeit, z.B. auch der DGhK, längst überwundene Vorurteile wieder aufleben zu helfen.
Leider machen sich bisher oft die falschen Leute in undifferenzierter Weise die Thesen von Herrn Rost für ihre eigene Veränderungsunwilligkeit zu eigen.
Das kann in niemandes Interesse sein.
Ein noch deutlicherer Einsatz von Herrn Rost im Sinne des Eintretens für Veränderung von Unterricht in Richtung wirklicher Differenzierung wäre da sicher hilfreich.
Dieser Teil seiner Ausführungen wird nämlich von denjenigen, die ihn ansonsten wortstark als Alibi für ihre Unwilligkeit, sich mit dem Thema Hochbegabung auseinanderzusetzen, benutzen oder auch missbrauchen, sehr gerne überhört, überlesen, übersehen.