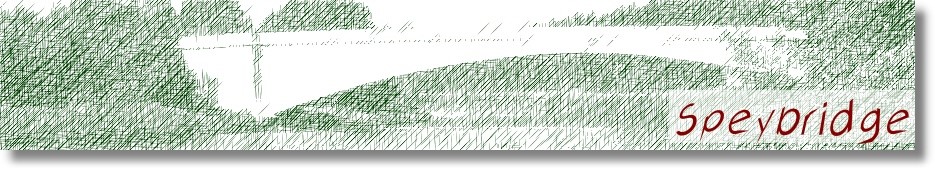Am 3.2. fand in Essen ein großes NRW-Symposium statt zum Thema „Individuelle Förderung“ – hochkarätig besetzt mit Ministerpräsident Rüttgers, Schulministerin Barbara Sommer und diversen Wissenschaftlern.
Innerhalb dieses Themas “Individuelle Förderung” ist ja nun das ganze mögliche (Leistungs-) Spektrum angesprochen von der Unterstützung schwacher Schüler bis hin zur Förderung bei Hochbegabung.
Obwohl sie wirklich “willig” waren, hat es mich doch sehr erschreckt, wie wenig die Politik all dem entgegenzusetzen hatte, was berichtet wurde z.B. aus der erfolgreichen Bildungspolitik Finnlands oder angesichts auch der Praxis einer Personalentwicklerin des RWE, sehr individuell Stärken-/Schwäche-Profile von Bewerbern zu erstellen, um beurteilen zu können, wo sie am günstigsten für sie selbst und den Konzern einen Platz finden können.
Es wurde von mehreren Seiten her ganz deutlich, dass Deutschland sich noch gar nicht wirklich auf den Weg hin zu einer modernen Bildungspolitik aufgemacht hat. Noch nicht einmal das!
Georg Schleicher (bei der OECD für die Pisa-Studien verantwortlich) in seinem Vortrag:
“Wir versuchen die Schüler des 21. Jahrhunderts zu unterrichten, durch Lehrer die im 20. Jahrhundert ausgebildet, doch seit ihrer Erstausbildung oft im Klassenzimmer allein gelassen wurden, und die in einem Schulsystem und einer Arbeitsumgebung arbeiten, die im Wesentlichen aus dem 19. Jahrhundert stammen:
- Ein Schulsystem, das nicht für optimales Lernen geschaffen wurde, sondern dafür, verlässlichen Output zu erzielen.
- Ein Schulsystem, für das der Zugang zu weiterem Lernen nicht für alle Schüler und zu jeder Zeit offen stand, sondern dessen Ziel darin bestand, relativ kostengünstig für eine ausreichende Zahl junger Menschen entscheidendes Basiswissen bereit zu stellen.
- Ein Schulsystem, dass nicht in erster Linie auf vertieftes Verständnis und die Motivation und Begeisterung für lebensbegleitendes Lernen abzielte, sondern darauf, junge Menschen auf die Werte und Arbeitsformen der Industriegesellschaft vorzubereiten.
Aber genau das funktioniert heute nicht mehr, denn die globale Wissenschaft stellt mittlerweile andere Anforderungen an Schüler, Lehrer und Schulen:
- In der Industriegesellschaft waren Märkte stabil, der Wettbewerb national ausgerichtet, und Organisationsformen hierarchisch. In der Wissensgesellschaft sind Märkte dynamisch, der Wettbewerb global und Organisationsformen vernetzt.
- In der Industriegesellschaft basierten Wachstumsimpulse auf Mechanisierung und Wettbewerbsvorteile auf “economies of scale”. Heute kommen Wachstumsimpulse aus Digitalisierung und Miniaturisierung und Wettbewerbsvorteile beruhen auf Innovation und Zeitnähe.
- In der Industriegesellschaft war das Firmenmodell der Einzelbetrieb, heute sind es flexible Allianzen der Mitbewerber; in der Industriegesellschaft war Vollbeschäftigung das politische Ziel, heute ist es “employability”, Menschen dazu zu befähigen ihren eigenen Horizont in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt zu erweitern.
- In der Industriegesellschaft hatten Berufsprofile eine klare Identität im berufsspezifischen Kontext und formale Qualifikationen waren der Schlüssel zum Erfolg. Heute sind Konvergenz, Transformation und lebensbegleitendes Lernen die entscheidenden Voraussetzungen.
Warum ist das Konzept der individuellen Förderung hier zum zentralen Schlüssel geworden?
Im Wesentlichen deshalb, weil es auf die Reproduktion von Routinewissen und Algorithmen, die man Schülern leicht im Gleichschritt vermitteln kann, in der modernen Wissensgesellschaft immer weniger ankommt. Klar ist, dass Dinge die man leicht in handliche Bausteine zerlegen und algorithmisieren kann, sich auch leicht testen und unterrichten lassen. Nur entwickeln wir damit zumeist Kompetenzen, die sich heute digitalisieren, automatisieren und outsourcen lassen, und jungen Menschen damit immer weniger helfen die globale Wissensgesellschaft mit zu gestalten. Außerdem nutzen wir das Potenzial junger Menschen nicht ausreichend, wenn wir alle mit den gleichen Methoden fördern und außer Acht lassen, dass gewöhnliche Schüler außergewöhnliche Fähigkeiten haben, die es individuell zu finden und fördern gilt.”Weiteres von Georg Schleicher in einem Interview.
Nötig wäre ein wirklicher Neuanfang. Die Zersplitterung der deutschen Bildungslandschaft dadurch, dass die Bildungshoheit bei den Ländern liegt, lässt aber nicht wirklich darauf hoffen. Bisher wird im Grunde nur versucht, ein ausgedientes System aufzuhübschen.
Rüttgers forderte allerdings die Schulen auf: “Macht! Wenn Ideen da sind – machen! Nicht soviel fragen!” Diese Aufforderung mag zwar zu einer farbigeren Schullandschaft und regional attraktiven Angeboten führen, bereitet aber nicht wirklich Weg, sondern schafft höchstens einen bunten Flickenteppich, der wahrscheinlich letztlich nicht weiterführt.
Erfreulich: Bei der Auszeichnung von 22 Schulen auf dem Symposium (Gütesiegel „Individuelle Förderung“) zeigte sich, dass in einzelnen Schulen tatsächlich ein Umdenken stattfindet. Ein Schulleiter: “Wir haben den Begriff der Schulreife für uns umdefiniert: Wir fragen nicht, ob das Kind reif ist für unsere Schule, sondern, ob wir als Schule reif sind, diesem Kind gerecht zu werden.”
Dieses Symposium ließ deutliche Ratlosigkeit zurück: die Richtung, in die das Bildungssystem sich bewegen müsste, ist klar. Wie allerdings der Weg dorthin, auf dem im Grunde kaum ein Stein auf dem anderen bleiben dürfte, aussehen könnte, das bleibt immer noch im Dunkeln. Es ist immerhin nicht weniger nötig als eine völlige Neuorientierung, ja eine “Revolution” des Schulsystems. Davor herrscht Angst. Es ist jedoch mittlerweile zu vermuten, dass die ständigen Reparaturversuche an einem System, das sich längst überholt hat, schon seit langem anstrengender sind, mehr Kräfte kosten bei zweifelhaftem Erfolg und entsprechend extrem frustrierender sind als es die Umbrüche zu einem Neuanfang auf dann tragendem, zukunftsfähigem Grund je sein würden.