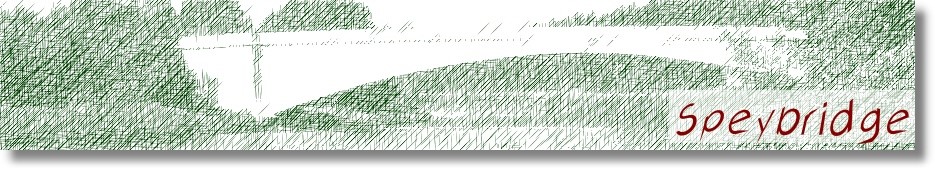Zurück in die Zukunft – Kopfnoten
Nun wird es also in NRW laut der neuen Ausbildungsordnung für die Sekundarstufe 1 ab dem nächsten Schuljahr wieder Kopfnoten geben – und zwar gleich sechs Stück!
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt, Verantwortungsbereit- schaft, Selbstständigkeit, Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit werden dann also zweimal im Jahr pro Schüler mit einer Note (sehr gut, gut, befriedigend, unbefriedigend) bewertet.
Diese in höchstem Maße zweifelhafte “Neuerung” ist an sich schon extrem kritisch zu bewerten. Bei Kindern mit Hochbegabung, so ist zu vermuten, wird es durch diese Regelung wahrscheinlich zu besonders gravierenden Ungerechtigkeiten kommen.
Nehmen wir also zunächst die “Leistungsbereitschaft“: Hochbegabte Kinder sind leistungsbereit, sogar in hohem Maße. Sollen sie aber über lange Zeit hinweg sie völlig unterfordernde kleinschrittige Wiederholungsaufgaben erledigen und nichts weiter, so werden sie sich dort sicherlich nicht hervortun. Sie bekommen oft gar keine Möglichkeit, ihre Leistungsbereitschaft unter Beweis zu stellen – und werden in dieser Kopfnote häufig nicht gut bewertet werden. Sind sie deswegen also weniger leistungsbereit???
Schon in den Fachnoten erlebt man deutliche Ungerechtigkeiten bei der Benotung Hochbegabter: ein mir bekannter Junge wurde im Physikunterricht gar nicht mehr aufgerufen mit der Begründung des Lehrers: “Ich frage dich nicht mehr; ich weiß ja, dass du das weißt.” Der Junge zeigte daraufhin logischerweise nicht mehr auf, bekam aber auch keine andere Möglichkeit, sein Wissen zu zeigen. Am Ende des Schuljahres sollte er gerade noch knapp eine 4 in Physik bekommen – wegen mangelnder mündlicher Beteiligung! Bei dieser konkreten Situation konnte man noch einschreiten, es gab ja auch Zeugen für die Aussage des Lehrers, aber bei einer “weichen” Note wie dieser Kopfnote “Leistungsbereitschaft” wird das schwieriger.
Zuverlässigkeit/Sorgfalt: Hochbegabte Kinder, die, wie alle anderen auch, hunderte von Rechenpäckchen zu einer mathematischen Lächerlichkeit schreiben oder wochenlang Lückentexte zu immer demselben sprachlichen “Problem” ausfüllen müssen, werden diese Aufgaben schnell nicht mehr mit der “nötigen” Sorgfalt erledigen, da sie einfach nur noch eine Qual darstellen. Noch eine schlechte Note.
Selbstständigkeit/Verantwortungsbereitschaft: Dabei wird meist verstanden, sich eigenständig im vorgegebenen Rahmen zu bewegen und dort evtl. auch Verantwortung zu übernehmen. Hochbegabte Kinder sprengen diesen Rahmen aber gerne durch Fragen, weitergehende inhaltliche Beiträge oder/und andersartige Arbeitswege. Dies wird dann gerne eher als unangemessen denn als gewünschte Selbstständigkeit bewertet. Notenmäßig zumindest kritisch für diese Kinder.
Dasselbe gilt für die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen: Hochbegabte Kinder sind dazu schon sehr früh in der Lage. Dies aber in einer evtl. dauerhaft als nicht erträglich empfundenen Situation tun zu sollen, kann für sie problematisch sein.
Konfliktverhalten: Ständige Unterforderung führt, vor allem bei Jungen, oft irgendwann zu auffälligem Verhalten im Unterricht. Bekannte Phänomene sind das Spielen des Klassenclowns, aktives Stören des als öde empfundenen Unterrichts und anderes.
Um wieder einmal das, meiner Meinung nach, sehr ausdrucksvolle und sprechende Bild des Schwimmers ins Spiel zu bringen: ein guter Schwimmer, der sich ewig mit Nichtschwimmern im Nichtschwimmerbecken mit Schwimmübungen beschäftigen muss, wird aus Frust und Unterforderung sehr schnell randalieren, andere untertauchen, bespritzen etc. Jeder wird das verstehen und dem Schwimmer die Möglichkeit geben, nach seinen Fähigkeiten trainieren zu können. Von hochbegabten “intellektuellen Schwimmern” aber wird erwartet, sich auf Jahre hin im “geistigen Nichtschwimmerbecken” gut zu benehmen, sich dabei auch noch zurückzuhalten und gute Miene zum öden Spiel zu machen. Das geht oft nicht gut, denn das ist eine Zumutung (die man einem guten Schwimmer definitiv ersparen würde)
Eine schlechte Note in “Konfliktverhalten” ist also häufig vorprogrammiert.
Kooperationsfähigkeit kann ein (hochbegabtes) Kind nur entwickeln, wenn mit ihm auch tatsächlich kooperiert wird, d.h., wenn es ernstgenommen und entsprechend seinen Möglichkeiten in die Pflicht genommen wird. Dann wird es dort kaum Schwierigkeiten geben. Teamarbeit mit Mitschülern, die letztlich mit den Beiträgen des hochbegabten Schülers nicht viel anfangen können, ist nur dann erfolgreich möglich, wenn diesem auch die Möglichkeit gegeben wird, Beiträge zu leisten, die ihm entsprechen. Wenn Kooperationsfähigkeit aber nur bedeutet, dass der/die Hochbegabte sich selbst ständig reduzieren muss, um in der Gruppe irgendwie zu überleben, kann es auch in diesem Notenbereich Probleme geben, weil das auf Dauer nicht auszuhalten ist.
Kopfnoten –
Zurück in die Zukunft?
Oder eher: Vorwärts in die Vergangenheit?